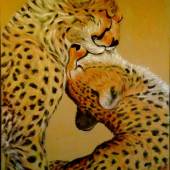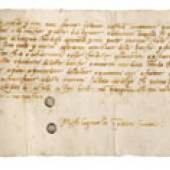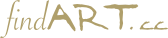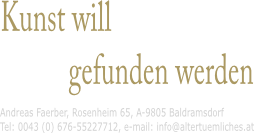Michelangelo.
Michelangelo. Zeichnungen und Zuschreibungen
-
Ausstellung06.03.2009 - 07.06.2009
Die Graphische Sammlung im Städel Museum zeigt vom 6. März bis 7. Juni 2009 eine Ausstellung, die sich an dem besonders umstrittenen Beispiel von Michelangelo Buonarroti (1475-1564) mit der Frage der Zuschreibung von Altmeisterzeichnungen beschäftigt. Michelangelo hat neben seinen weltberühmten Skulpturen, Fresken und Bauwerken eine große Anzahl von Zeichnungen geschaffen, die zu seinen Lebzeiten sehr bewundert wurden. Da er sie nie signiert hat und viele kurz vor seinem Tod verbrannte, ist heute bei vielen erhaltenen Blättern nicht einfach zu bestimmen, ob sie tatsächlich eigenhändig sind oder ob es sich um Kopien oder Nachahmungen anderer Künstler handelt. Anlass für die Ausstellung bildet eine Zeichnung in der Graphischen Sammlung des Städel Museums, deren Zuschreibung an Michelangelo in der Vergangenheit kontrovers diskutiert wurde. Zuletzt wurde sie von einigen Experten erneut Michelangelo zugeschrieben.

Anhand ausgewählter Beispiele - darunter kostbare Leihgaben aus den Sammlungen des British Museum, London, der Royal Collection, Windsor, der Casa Buonarroti, Florenz - bietet die Ausstellung verschiedene Möglichkeiten des unmittelbaren visuellen Vergleichs, um den Besuchern Gelegenheit zu einer eigenen Auseinandersetzung mit dieser Frage vor originalen Werken zu geben.
Die Ausstellung „Michelangelo. Zeichnungen und Zuschreibungen" wird von der Hannelore Krempa Stiftung gefördert. Das Blatt aus der Sammlung des Städel Museums, die „Grotesken Köpfe und weitere Studien", wurde im 19. Jahrhundert als Werk Michelangelos erworben, ihm seitdem zu- oder teilweise zu-, um 1980 jedoch abgeschrieben. Da verschiedene Experten in den letzten Jahren mehrfach die Meinung äußerten, es handle sich hier doch um ein eigenhändiges Werk Michelangelos, entstand der Plan für eine Ausstellung, die sich nicht darauf beschränken sollte, das in Frage stehende Blatt zu behandeln, sondern sich allgemeiner dem Problem des „Zuschreibens" zu widmen. Dabei gilt es zu betonen, dass es sich bei den „Grotesken Köpfen" nicht um eine „Neuentdeckung", sondern um die erneute Zuschreibung eines seit Langem bekannten Blattes handelt.
Die Graphische Sammlung im Städel Museum besitzt eine herausragende Sammlung von Zeichnungen der italienischen Renaissance, die zu den besten in Deutschland gehört. Sie wurde vor allem von dem großen Kenner Johann David Passavant (1787-1861) aufgebaut, der von 1840 bis zu seinem Tod als Inspektor der Galerie die Sammlungen des Städel um viele wertvolle Erwerbungen bereichert hat. Der nazarenische Maler Passavant war ein Spezialist, was Raffael betraf, dessen Zeichnungen heute zu den Spitzenstücken der Städel'schen Sammlung zählen. Beim Ankauf von Werken Michelangelos bewies Passavant jedoch eine weniger glückliche Hand; es gelangen ihm nur wenige, nicht zweifelsfreie Erwerbungen, weshalb das Blatt der „Grotesken Köpfe" in Frankfurt verhältnismäßig wenig beachtet blieb.
Die Ausstellung umfasst 24 Werke. Zwölf - teilweise doppelseitige - Zeichnungen und zwei Briefe sind (mit der in dieser Frage möglichen Wahrscheinlichkeit) ganz oder teilweise eigenhändige Arbeiten Michelangelos. Die anderen Werke sind Vergleichsbeispiele, zum Teil aus der Sammlung des Städel Museums. Unter den Michelangelo-Zeichnungen befinden sich weltbekannte Meisterwerke wie der „Ideale Frauenkopf", die „Auferstehung" oder das Studienblatt mit der Ermahnung an Antonio Mini.

Die Ausstellung ist in sieben Kapitel unterteilt. Im ersten geht es um einen Vergleich einer Zeichnung Michelangelos mit der Darstellung des „Lazarus" mit einer seines Freundes, des Malers Sebastiano del Piombo. Letztere stammt aus der Sammlung des Städel Museums. Beide Zeichnungen entstanden für dasselbe Gemälde, die von Sebastiano ausgeführte „Auferweckung des Lazarus" (heute in der National Gallery, London). Da sich Sebastiano in einer Konkurrenzsituation zu Michelangelos größtem Rivalen, Raffael, befand, unterstützte Michelangelo seinen Freund mit Entwurfszeichnungen. Diese sind von der Forschung teilweise für Werke Sebastianos gehalten worden. In der Ausstellung ist es möglich, die unterschiedliche Zeichenweise des venezianischen Malers Sebastiano und des Florentiner Bildhauers Michelangelo unmittelbar zu vergleichen.
Schon in der „Lazarus"-Zeichnung werden die wichtigsten Eigenschaften des zeichnerischen Stils Michelangelos deutlich: Er „modelliert" beim Zeichnen, das heißt, er versucht nicht so sehr unterschiedliche Material- oder Flächenwirkungen zu erzeugen, wie es Maler gerne tun, sondern interessiert sich stärker für Dreidimensionalität und die Interaktion von Körper und Raum; er ist sehr erfinderisch, vor allem was ausdrucksvolle Körperhaltungen angeht, er baut Körper von innen, von ihrer Anatomie her, auf und legt seine Zeichnungen gerne in „Schichten" an, indem er mit ganz leichten Strichen anfängt und das Motiv dann mit immer stärker gesetzten Akzenten ausarbeitet. Er zeichnet zügig und energisch.
-
27.11.2024 - 23.03.2025Amsterdam – eine Stadt, viele Gesichter. Im 17. Jahrhundert ist Amsterdam die Metropole...
-
13.12.2024 - 18.05.2025Das Meer, ein Blick: An verschiedenen Stränden der Welt – in Polen, Großbritannien, der...
-
12.02.2025 - 01.06.2025Die Fotografien von Carl Friedrich Mylius (1827–1916) sind künstlerisch herausragende Werke...
-
06.03.2009 - 07.06.2009